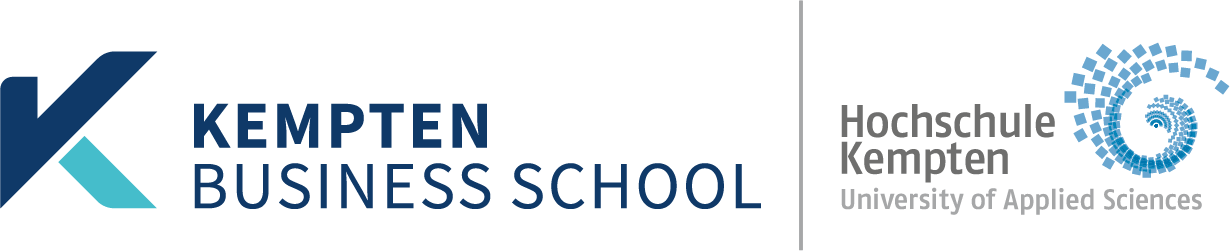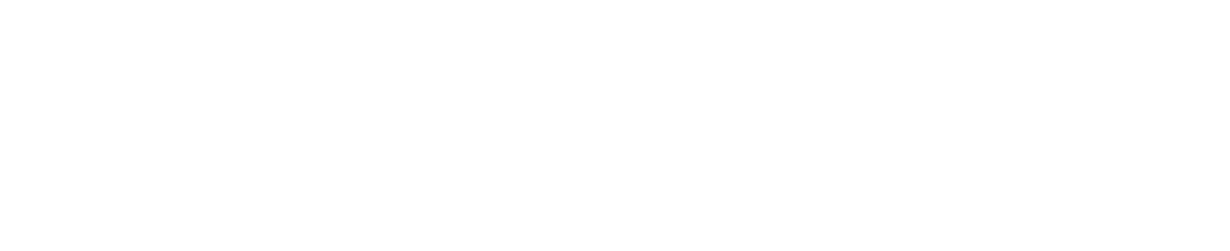In einer Arbeitswelt, die zunehmend von Digitalisierung, Flexibilisierung und hybriden Teamstrukturen geprägt ist, wird Teamarbeit zur tragenden Säule für Unternehmenserfolg. Doch: Teamleistung ist nicht automatisch gegeben – selbst wenn es gut organisiert scheint. Entscheidend ist, was „unter der Oberfläche“ wirkt.
Was macht ein leistungsfähiges Team wirklich aus?
Die Forschung zeigt deutlich: Die bloße Zusammenstellung von Kompetenzen genügt nicht. Vielmehr beeinflussen tiefere, oftmals unsichtbare Faktoren wie Persönlichkeitsstrukturen, Rollenverständnisse und das soziale sowie physische Arbeitsumfeld maßgeblich die tatsächliche Teamleistung. Ein Team kann nur dann Synergien freisetzen, wenn die Mitglieder nicht nur fachlich fähig, sondern auch psychologisch und funktional kompatibel sind. Ein gängiges Missverständnis besteht also darin, anzunehmen, dass möglichst ähnliche oder möglichst unterschiedliche Menschen automatisch gut zusammenarbeiten. In Wahrheit ist es komplexer: Die richtige Mischung hängt stark von der konkreten Aufgabe, dem Ziel des Teams und den bestehenden Rahmenbedingungen ab. Nur wer diese vielschichtigen Einflüsse berücksichtigt, kann ein Team wirklich leistungsstark entwickeln.
Das „Fünf-Faktoren-Modell“
Vielmehr beeinflussen tieferliegende Faktoren wie Persönlichkeitsstrukturen, Rollenverständnisse und das Arbeitsumfeld maßgeblich die Teamleistung. Ein Team kann nur dann Synergien freisetzen, wenn die Mitglieder nicht nur fähig, sondern auch kompatibel sind, psychologisch wie funktional. Das sogenannte „Fünf-Faktoren-Modell“ der Persönlichkeit (Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität) bietet dabei wichtige Hinweise. Studien belegen, dass gezielte Heterogenität, zum Beispiel in der Extraversion, die Teamleistung steigern kann, wenn Aufgabe und Kontext passen.
Darüber hinaus spielen Teamrollen z. B. Macher, Koordinator oder Spezialist – und deren bewusste Besetzung eine zentrale Rolle. Jede dieser Rollen bringt bestimmte Stärken – und potenzielle Schwächen – mit sich.
Der Macher etwa treibt Prozesse voran, kann aber auch ungeduldig werden. Der Spezialist bringt tiefes Fachwissen ein, könnte sich jedoch vom Teamgefüge entfernen. Wichtig ist daher nicht nur die Rollenverteilung, sondern auch ein gegenseitiges Verständnis dafür, wie diese Rollen sich ergänzen. Die bewusste Auseinandersetzung mit Rollen schafft Klarheit, verhindert Missverständnisse und sorgt für eine höhere psychologische Sicherheit. Sie trägt dazu bei, dass sich Teammitglieder nicht nur für ihre Aufgaben, sondern auch für ihre Wirkung im Team verantwortlich fühlen.
Ergänzt wird dies durch das Umfeld: Führung, Unternehmenskultur und Transparenz schaffen den „Nährboden“ für Leistung. Ein unterstützendes Umfeld wirkt wie ein Katalysator für Teamleistung. Führungskräfte spielen dabei eine doppelte Rolle: Sie agieren nicht nur als Richtungsgeber und Entscheidungsträger, sondern auch als Moderatoren, Konfliktlöser und Kulturträger.
Gute Führung bedeutet, Räume für Verantwortung und Vertrauen zu schaffen, anstatt nur Kontrolle auszuüben.
Die Unternehmenskultur beeinflusst wiederum, wie mit Fehlern umgegangen wird, wie Innovation gefördert wird, ob Vielfalt geschätzt oder homogenisiert wird. In Kulturen, die psychologische Sicherheit und Diversität fördern, zeigen Teams tendenziell höhere Zufriedenheit, mehr Engagement und bessere Ergebnisse.
Und was kannst du nun aktiv machen? Um Teamleistung nicht dem Zufall zu überlassen, sondern gezielt zu fördern, helfen drei zentrale Maßnahmen:
1. Teams bewusst und strategisch zusammenstellen
Die Frage sollte nicht nur lauten „Wer kann was?“, sondern ebenso: „Wer ist wie?“. Persönlichkeitsprofile bieten hier wertvolle Einblicke. Eine gute Passung der Persönlichkeitsmerkmale, wie eine ausgewogene Mischung aus Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Extraversion, erhöht die Wahrscheinlichkeit produktiver Zusammenarbeit.
Tools wie das BIP (Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung) oder der NEO-FFI können helfen, solche Profile zu erfassen und gezielt einzusetzen. Wichtig: Persönlichkeitstests sollten nie alleinige Entscheidungsgrundlage sein, sondern immer in Kombination mit Beobachtungen, Interviews und Teamgesprächen verwendet werden.
2. Rollen im Team klar definieren und bewusst besetzen
Erfolgreiche Teams funktionieren wie gut abgestimmte Orchester. Jeder spielt ein anderes Instrument, aber alle folgen demselben Rhythmus. Damit das gelingt, müssen Rollen nicht nur besetzt, sondern verstanden und wertgeschätzt werden.
Das Belbin-Modell bietet hier eine gute Grundlage. Führungskräfte oder HR-Partner können anhand von Workshops oder strukturierten Interviews erheben, welche Rollen im Team stark vertreten sind und welche vielleicht fehlen. Fehlt etwa ein „Beobachter“, kann es sein, dass kritische Fehler übersehen werden. Fehlt ein „Koordinator“, leidet das Projekt an Orientierungslosigkeit.
Die bewusste Verteilung von Rollen verhindert außerdem Überlastung und hilft, Konflikte frühzeitig zu entschärfen – bevor sie eskalieren.
3. Das Umfeld aktiv gestalten
Teamleistung entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie braucht Strukturen, Ressourcen und vor allem Kultur. Führungskräfte sind dabei in der Verantwortung, ein Umfeld zu schaffen, in dem Vertrauen, Selbstverantwortung und konstruktive Kommunikation möglich sind.
Konkret heißt das:
- Feedbackkultur etablieren – regelmäßig, ehrlich, entwicklungsorientiert
- Transparenz schaffen – z. B. über Ziele, Rollen, Entscheidungswege
- Rituale pflegen – z. B. Team-Check-ins, Retrospektiven, gemeinsames Feiern von Erfolgen
- Diversität fördern – nicht nur hinsichtlich Herkunft und Geschlecht, sondern auch in Denkweisen und Perspektiven
Weitere wichtige Tipps zur Mitarbeiterentwicklung hat Prof. Dr. Katrin Winkler in einem Artikel zusammengefasst.
Ein unterstützendes Umfeld ist übrigens nicht gleichbedeutend mit Komfortzone. Es kann fordernd sein – aber es gibt Halt und Richtung. Wer Teamleistung verstehen und verbessern will, muss daher tiefer schauen: auf Persönlichkeitsprofile, Aufgabenstruktur und soziale Dynamiken. Nur so kann Teamarbeit ihr volles Potenzial entfalten – analog wie virtuell. Besonders relevant wird das Thema Teamleistung in der heutigen Arbeitsrealität hybrider Teams – also Teams, die teils remote, teils vor Ort arbeiten. Diese Konstellation bringt neue Herausforderungen mit sich:
- Wie gelingt soziale Bindung ohne tägliche Präsenz?
- Wie werden Informationen transparent geteilt?
- Wie kann man Vertrauen digital aufbauen?
Hier ist ein noch bewussteres Teamdesign gefragt: Klare Kommunikationsregeln, gemeinsame Tools und regelmäßige Touchpoints – auch informeller Art – sind unerlässlich. Auch Führung muss sich anpassen: weniger Kontrolle, mehr Vertrauen, mehr Empathie.
Gleichzeitig bietet hybride Arbeit auch Chancen: Teams können global zusammengestellt werden, unterschiedliche Perspektiven einbringen und ortsunabhängig Talente nutzen. Voraussetzung ist, dass die psychologische Nähe trotz physischer Distanz erhalten bleibt.
Fazit
Heutige Teamarbeit ist kein Selbstläufer. Sie ist eine bewusste Gestaltungsaufgabe – für Führungskräfte, für Organisationen, aber auch für jedes Teammitglied selbst. Denn nur wer sich selbst und sein Team versteht, kann Verantwortung übernehmen – und echte Leistung ermöglichen. Analog wie virtuell.
Literatur:
1 König, S. & Niedermeier, S. (2022). Säulen der Teamleistung in realen, virtuellen & hybriden Teams
2 Betrachtung von Teamleistung in Zeiten der Digitalisierung. In Wilbers, K. (Hrsg.), Handbuch E-Learning, Loseblattwerk, Hürth, Beitrag Nr. 7.47, 97. Erg.-Lfg. Juni 2022
21.07.2025
Kategorien:
Schlagwörter: