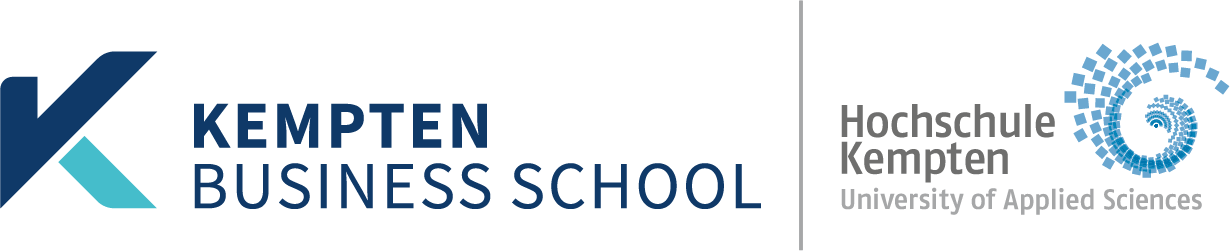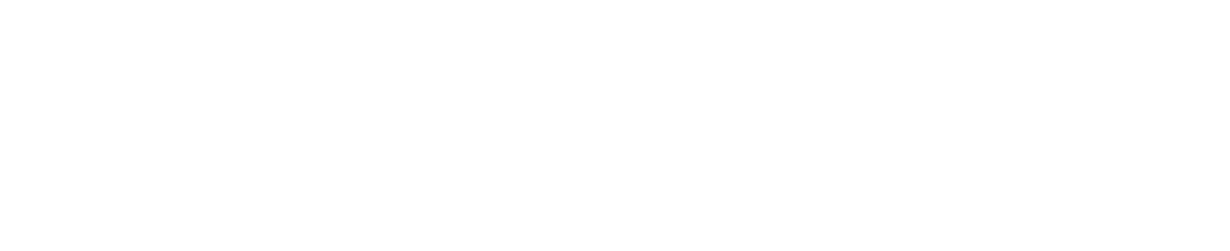Der sich verschärfende Fachkräftemangel in Deutschland stellt Wirtschaft, Bildungsinstitutionen und Politik vor akuten Handlungsbedarf. Während demografische Veränderungen und technologische Disruptionen als strukturelle Treiber gelten, zeigt sich zunehmend, dass die Hochschulen nicht ausreichend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereiten. Insbesondere im Hinblick auf digitale Kompetenzen, kritische Selbstreflexion und Praxisbezug klafft eine deutliche Lücke. Der vorliegende Beitrag beleuchtet diese Problematik und entwickelt darauf aufbauend die These, dass Unternehmen gezwungen sind, selbst aktiv als Bildungsakteure aufzutreten.
Das Engagement und die Investitionen von Unternehmen für Bildung dürfen dabei nicht als Selbstzweck begriffen werden. Vielmehr sind sie als ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Innovationskraft und zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit zu betrachten. (Al-Mahruqi, 2023) Die Förderung von Bildung und Gewährleistung von Chancengerechtigkeit bilden zugleich einen zentralen Baustein in der Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung (BMFTR, 2018). Und nicht zuletzt ist eine starke Bildung ein wichtiger Faktor für qualifizierte Mitarbeitende, die in Unternehmen dringend benötigt werden. In diesem Kontext helfen Investitionen in Bildung Unternehmen dabei, sich für junge Talente als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und ihr Image zu verbessern. (Al-Mahruqi, 2023)
Zwischen Selbstüberschätzung und Realität: Warum Feedbackkompetenz über berufliche Anschlussfähigkeit entscheidet
In ihrem Buch Akadämlich beschreibt Zümrüt Gülbay-Peischard (2024) pointiert die Diskrepanz zwischen studentischer Selbstwahrnehmung und arbeitsmarktrelevanter Realität. Bereits der Eingangssatz – „Deutschlands Studierende sind faul, lethargisch, handysüchtig, arrogant, überschätzen sich und haben keine Ahnung davon, was der Arbeitsmarkt von ihnen will“ (S. 11) – formuliert eine provokante, empirisch aber vielfach bestätigte Kritik an mangelnder Selbstreflexion und realitätsferner Erwartungshaltung.
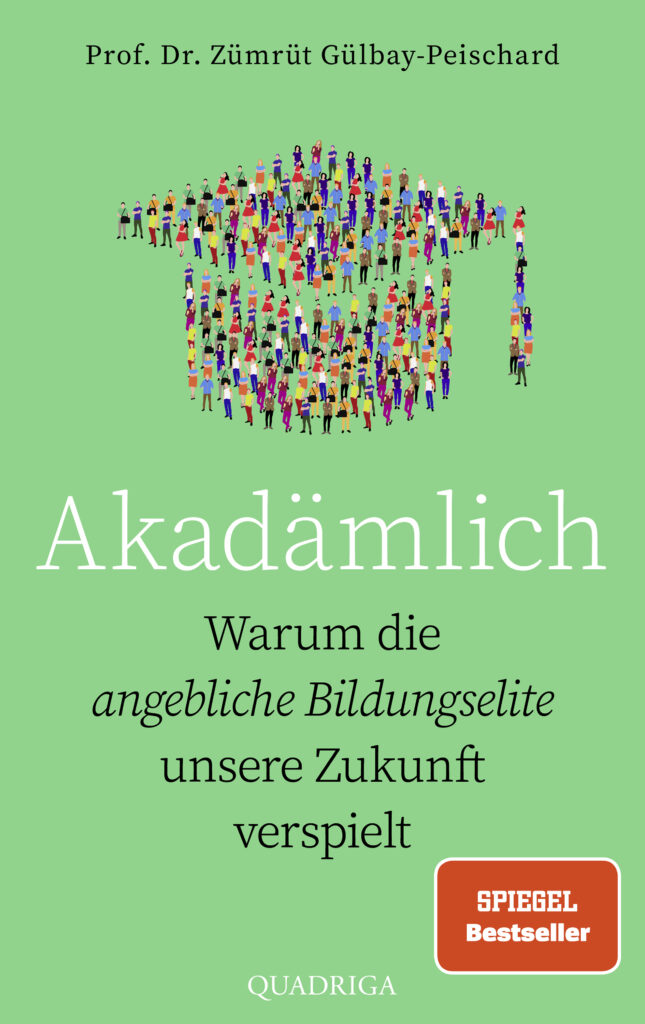
Akadämlich
Warum die angebliche Bildungselite unsere Zukunft verspielt
Kaum ein Satz ohne Rechtschreibfehler, aber am liebsten morgen schon einen gut bezahlten Job in der freien Wirtschaft. Zu jedem Thema eine Meinung, aber Kritik an sich selbst als Majestätsbeleidigung verstehen. Junge Menschen aus wohlstandsverwöhnten Generationen erwarten, dass ihnen alles auf dem Silbertablett serviert wird: von Leistungs- und Leidensbereitschaft haben sie nie etwas gehört. Deshalb haben sie sogar das Lernen verlernt oder gar nicht erst gelernt. Zümrüt Gülbay-Peischard entlarvt die Ursachen der Bildungsmisere an deutschen Hochschulen und zeigt ihre Folgen: Hochschulen sind immer weniger in der Lage, die dringend benötigten Topkräfte für den Arbeitsmarkt auszubilden. Die Autorin geht mit der Generation Z hart ins Gericht, die Ignoranz und Lethargie der Studierenden empfindet sie als geradezu unanständig.
Diese Diagnose deckt sich mit hochschuldidaktischen Erfahrungen: In einem exemplarischen Fall zeigte sich eine Masterstudentin „schockiert“ über eine Note von 2,3, obwohl diese durch ein fundiertes Gutachten wegen suboptimalen wissenschaftlichen Arbeitens nachvollziehbar begründet war. Derartige Reaktionen weisen auf ein verzerrtes Leistungsverständnis und eine fehlende Feedbackkompetenz hin – beides zentrale Faktoren beruflicher Anschlussfähigkeit.
Feedbackkompetenz
Die Fähigkeit, Rückmeldungen konstruktiv zu geben und anzunehmen – ist entscheidend für die berufliche Entwicklung. Studien zeigen, dass regelmäßiges und qualitativ hochwertiges Feedback die Lernbereitschaft erhöht und die Selbstwirksamkeit stärkt, was wiederum die Employability verbessert (vgl. z.B. Wunderer, 2003; Belschak et al., 2008).
Die Fähigkeit, Feedback zu akzeptieren und daraus zu lernen, ist ein zentraler Bestandteil der beruflichen Anschlussfähigkeit. Wie auch Rödel und Krach (2023) betonen, verbessert eine ausgeprägte Feedbackkultur nicht nur die Zusammenarbeit im Team, sondern auch die individuelle Leistung. Mitarbeitende mit hoher Feedbackkompetenz zeigen eine höhere Bereitschaft zur Selbstreflexion und kontinuierlichen Verbesserung, was sie für Arbeitgeber besonders wertvoll macht.
Darüber hinaus zeigt eine Untersuchung von Rödel und Krach (2023), dass in modernen Arbeitsumgebungen, die durch agile Methoden und flache Hierarchien geprägt sind, eine ausgeprägte Feedbackkultur unerlässlich ist. Sie ermöglicht es Mitarbeitenden, sich schnell an Veränderungen anzupassen und proaktiv an der Weiterentwicklung von Prozessen teilzunehmen. Die Entwicklung von Feedbackkompetenz sollte daher bereits im Studium beginnen. Hochschulen sind gefordert, Studierende nicht nur fachlich auszubilden, sondern ihnen auch die notwendigen Soft Skills zu vermitteln, die für den erfolgreichen Übergang in die Arbeitswelt erforderlich sind. Dies umfasst gezielte Trainings in Kommunikationsfähigkeiten, Selbstreflexion und dem Umgang mit Kritik.
Insgesamt zeigt sich, dass Feedbackkompetenz ein entscheidender Faktor für die berufliche Anschlussfähigkeit ist. Sie ermöglicht es Individuen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, effektiv im Team zu arbeiten und den Anforderungen eines dynamischen Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Die Förderung dieser Kompetenz sollte daher ein integraler Bestandteil sowohl der akademischen Ausbildung als auch der beruflichen Weiterbildung sein.
Digitalisierungsdefizite in der Hochschullehre – Verpasste Vorbereitung auf die digitale Arbeitswelt
Zahlreiche Studien zeigen, dass deutsche Hochschulen bei der Digitalisierung hinterherhinken – mit weitreichenden Folgen für die berufliche Anschlussfähigkeit ihrer Absolventen. Wer im Studium nicht lernt, digital zu arbeiten, wird später im Unternehmen massive Anpassungsprobleme haben.
Zwar sprechen viele von einem Digitalisierungsschub durch die Coronapandemie. Laut Bitkom-Studie (Wintergerst, 2024) sehen 73 % der befragten Studierenden Fortschritte an ihrer Hochschule – doch dieselbe Anzahl kritisiert gleichzeitig, dass Deutschland international stark zurückliege. 64 % sind der Meinung, dass deutsche Hochschulen die Digitalisierung verschlafen hätten. Dieses ambivalente Bild weist auf strategische Versäumnisse und eine mangelhafte Umsetzung in der Breite hin.
Der Monitor Digitalisierung 360° des Hochschulforums Digitalisierung bestätigt: Zwar beschäftigen sich rund die Hälfte der Hochschulen strategisch mit hybriden oder Blended Learning-Formaten – doch auf Umsetzungsebene zeigen sich Lücken. Vor allem fehlt es an konsequenter Kompetenzorientierung: Zukunftsrelevante Formate wie problembasiertes Lernen, Peer-Learning oder forschendes Lernen, die digitale und soziale Fähigkeiten fördern, werden kaum als profilbildende Elemente verankert.
Auch im Umgang mit generativer KI zeigen sich Defizite
Nur 35,6 % der Hochschulleitungen haben das Thema in Strategieprozesse eingebunden, 44,4 % entwickeln aktuell überhaupt erst Angebote zur Förderung von KI-Kompetenzen. Aus Sicht der Studierenden ist das zu wenig: Das bestehende Angebot wird durchschnittlich nur mit der Note 3,26 bewertet (Wintergerst, 2024). 38 % der Befragten sagen, sie fühlten sich an ihrer Hochschule nicht auf die Anforderungen der digitalen Welt vorbereitet, 53 % wünschen sich explizit mehr Angebote zum Erwerb von Digitalkompetenzen – z. B. Scrum- oder Programmierkurse. 68 % fordern eine stärkere Integration digitaler Technologien in Studium und Lehre.
Diese Daten sind mehr als nur Kritik an der Lehre – sie sind ein Weckruf. Unternehmen erwarten heute von Absolventen nicht nur Fachwissen, sondern digitale Souveränität, Kollaborationsfähigkeit in hybriden Teams und ein Verständnis für KI-gestützte Prozesse. Wer diese Fähigkeiten nicht im Studium erwirbt, startet mit klaren Nachteilen in den Beruf. Hochschulen, die dieser Verantwortung nicht nachkommen, gefährden damit die Anschlussfähigkeit ganzer Generationen an die digitalisierte Arbeitswelt.
Praxis schlägt Theorie: Warum Hochschulen mehr tun müssen, um Studierende beruflich anschlussfähig zu machen
In einer zunehmend digitalen und dynamischen Arbeitswelt sind theoretisches Wissen allein und klassische Lernformate nicht mehr ausreichend, um junge Menschen wirksam auf ihren Berufseinstieg vorzubereiten. Entscheidend ist der Erwerb praktischer, erfahrungsbasierter Kompetenzen – insbesondere in digitalen und kollaborativen Kontexten. Doch genau hier liegt eine der größten Schwächen des aktuellen Hochschulsystems. Laut der Umfrage unicensus kompakt des Personaldienstleisters univativ (Redaktion Personalwirtschaft, 2015; Dämon, 2015) betrachten lediglich 16 % der über 1.000 befragten Studierenden in Deutschland die Hochschule als beste Vorbereitung auf das Berufsleben. Demgegenüber schreiben 56 % vor allem Praxissemestern und Praktika diese Rolle zu, weitere 23 % sehen Nebenjobs als hilfreich für den Berufseinstieg. Besonders relevant: Praktische Erfahrungen gelten auch für Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Innovation als wichtigste Quelle fachlicher Aktualität.
Zwar fühlen sich 60 % der Befragten durch ihr Studium gut auf die Inhalte ihres Fachgebiets vorbereitet – doch es fehlt die Brücke zur Anwendung im realen Arbeitskontext. Hier wird eine Lücke sichtbar, die viele Hochschulen bislang nicht ausreichend schließen. Insbesondere für Zukunftskompetenzen wie kritisches Denken, digitales Arbeiten, kollaborative Problemlösung und der Umgang mit KI sind praxisnahe Lernformate unverzichtbar.
Diese Herausforderungen unterstreichen auch aktuelle Studien
So zeigen Diermeier, Geis-Thöne und Schleiermacher (2024) in einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft mit dem Verband der Privaten Hochschulen, dass insbesondere Unternehmen den engen Praxisbezug und die unmittelbare Arbeitsmarktorientierung privater Hochschulen hochschätzen. Fast 48 % der befragten Unternehmen sehen hier den zentralen Vorteil, 47 % sprechen privaten Hochschulen die Fähigkeit zu, Absolvent:innen schnell in den Beruf zu integrieren.
Ein entscheidender Faktor für diesen Erfolg: die Möglichkeit, berufsbegleitend zu studieren. Durch die enge Verzahnung mit der Praxis entstehen in den Seminaren Erfahrungsräume, die nicht nur theoretische Inhalte greifbarer machen, sondern auch Raum für aktuelle, unerwartete Fragestellungen bieten. Programme wie die der Kempten Business School zeigen exemplarisch, wie Weiterbildung praxisnah, flexibel und anschlussfähig gestaltet werden kann. Die Teilnehmenden bringen reale berufliche Herausforderungen mit, die in den Kursen gemeinsam reflektiert und gelöst werden – ein Gewinn für alle Beteiligten.
Master
Berufsbegleitend
MBA International Business Management and Leadership
Nächste Info-Session am Donnerstag, 15. Januar 2026 – 19:30 UhrJetzt unverbindlich anmelden!
Doch diese Entwicklung darf nicht allein privaten Bildungsträgern überlassen bleiben. Wenn staatliche Hochschulen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden wollen, müssen sie dringend nachziehen. Die Anforderungen des Arbeitsmarktes verändern sich rasant – Studierende, die an starren, theorielastigen Curricula festgehalten werden, drohen beruflich den Anschluss zu verlieren.
Der verstärkte Fokus auf berufsbegleitende und praxisnahe Weiterbildungsangebote, wie er derzeit vor allem in Bayern ausgebaut wird, ist ein erster wichtiger Schritt. Doch es braucht mehr: staatliche Hochschulen müssen ihre Lehrkonzepte grundlegend reformieren – kompetenzorientierter, digitaler, flexibler. Nur so können sie ihrer Rolle als Wegbereiter für eine zukunftsfähige, beschäftigungsfähige Gesellschaft gerecht werden.
Fachkräftemangel als strukturelles Risiko
Der Fachkräftemangel in Deutschland ist längst kein temporäres Phänomen mehr, sondern ein tiefgreifender struktureller Engpass mit weitreichenden ökonomischen Folgen. Laut einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (Burstedde & Tiedemann, 2024), in der die Entwicklung von 1.300 Berufen bis ins Jahr 2027 analysiert wurde, könnten unter Fortschreibung bisheriger Trends bis 2027 rund 728.000 Fachkräfte fehlen. Besonders betroffen sind laut einer Erhebung der ManpowerGroup (2025) die Branchen Energie, Gesundheitswesen und IT – zentrale Sektoren für Transformation und Zukunftssicherung.
Mit einem Rekordwert von 86 % geben deutsche Arbeitgeber an, Schwierigkeiten bei der Besetzung qualifizierter Stellen zu haben – ein Wert, der sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat und deutlich über dem globalen Durchschnitt von 74 % liegt. Deutschland belegt damit einen weltweiten Spitzenplatz im negativen Sinne.
Die Folgen dieses Mangels sind gravierend: Innovationskraft, Produktivität und die Erreichung strategischer Ziele wie Digitalisierung, Klimaschutz und nationale Sicherheit sind akut gefährdet – insbesondere durch die Lücken im MINT-Bereich. Der MINT-Frühjahrsreport 2025 (Anger, Betz & Plünnecke, 2025) zeigt: Im April 2025 standen rund 387.100 offenen MINT-Stellen lediglich 248.757 arbeitslose Bewerber mit Interesse an einem solchen Beruf gegenüber. Selbst ohne tiefere Differenzierung ergibt sich daraus bereits eine Lücke von mindestens 138.343 Stellen – bereinigt um Qualifikationsmismatch sogar 163.600 fehlende Fachkräfte.
Bildung als Schlüssel gegen den Fachkräftemangel: Warum Unternehmen jetzt investieren müssen
Die Dimension des Problems ist unbestritten – und doch wird eine zentrale Lösung noch zu wenig genutzt: Bildung und Weiterbildung als strategischer Hebel. Die genannte Studie der ManpowerGroup (2025) macht deutlich, dass nur 23 % der befragten 1.050 Arbeitgeber aktuell auf Qualifizierung und Umschulung ihrer Mitarbeitenden setzen, um den Engpass zu begegnen. Dabei liegt genau hierin ein entscheidender Schlüssel.
Unternehmen, die in Weiterbildung und Kompetenzentwicklung investieren, stärken nicht nur ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit – sie leisten einen gesellschaftlichen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Lebenslanges Lernen, Qualifizierungsprogramme und berufsbegleitende Bildungsangebote schaffen flexible und anschlussfähige Beschäftigte, die mit dem Wandel Schritt halten können.
Gleichzeitig braucht es dafür verlässliche Strukturen und starke Partnerschaften mit dem Bildungssektor. Programme zur berufsbegleitenden Weiterbildung – wie sie beispielsweise von Hochschulen und Business Schools zunehmend angeboten werden – schaffen neue Bildungswege und machen Qualifikationen zugänglich, ohne Erwerbsbiografien zu unterbrechen. Die in Bayern verstärkte Fokussierung auf flexible Weiterbildungsmodelle ist ein erster, richtiger Schritt. Sie müssen nun systematisch ausgebaut und auch von Unternehmen aktiv genutzt und gefördert werden.
Der Fachkräftemangel wird sich nicht durch bloßes Recruiting beheben lassen. Wer zukunftsfähig bleiben will, muss in Bildung investieren – gezielt, langfristig und partnerschaftlich. Unternehmen haben dabei eine zentrale Verantwortung. Bildung ist kein Kostenfaktor, sondern der stärkste Hebel für Stabilität, Innovationskraft und Wachstum.
Unternehmen als Bildungsakteure
Angesichts des sich verschärfenden Fachkräftemangels übernehmen Unternehmen zunehmend Verantwortung für die Qualifikation zukünftiger Mitarbeitender – nicht als Ergänzung, sondern als notwendige Ergänzung zu staatlichen Bildungseinrichtungen. Sie entwickeln sich zu aktiven Bildungsakteuren, indem sie gezielt in Programme zur berufsbegleitenden Qualifizierung, Nachwuchsförderung und internen Weiterbildung investieren.
Innovative Bildungsprojekte wie die von Volkswagen und SAP unterstützte École 42 in Berlin zeigen, wie Unternehmen alternative Bildungsformate schaffen, um digitale Fachkräfte selbst auszubilden. Die 42 Berlin, ein revolutionäres Konzept ohne Lehrkräfte und ohne formale Zugangsvoraussetzungen, ergänzt klassische Aus- und Weiterbildungswege. Parallel dazu betrieb Volkswagen bis 2023 mit der Fakultät 73 ein internes Ausbildungsprogramm zur Qualifikation von Softwareentwicklern – Hunderte wurden dort umgeschult, um gezielt den MINT-Fachkräftebedarf zu decken (Zwick, 2022; Krause, 2024).
Ein weiteres Beispiel bietet das Forscherinnen-Camp von KUKA in Kooperation mit den Bildungswerken der Bayerischen Wirtschaft. Dort wurden gezielt Schülerinnen für Zukunftstechnologien wie Robotik und KI begeistert – ein wichtiger Beitrag zur Erschließung bislang unterrepräsentierter Potenziale im MINT-Bereich (Schoenwetter, 2023). Solche Initiativen zeigen: Unternehmen können und müssen Bildungsräume schaffen, um sowohl bestehende Lücken zu schließen als auch neue Talente frühzeitig zu fördern.
Handlungsempfehlungen: Bildungspartnerschaften gezielt ausbauen
Um ihre Rolle als Bildungsakteure nachhaltig auszufüllen, sollten Unternehmen auf mehreren Ebenen aktiv werden:
1. Frühzeitige Kooperationen:
Partnerschaften mit Schulen und Hochschulen ermöglichen Jugendlichen Einblicke in Berufsfelder und schaffen Orientierung. Praktika, Werkstudententätigkeiten oder Ferienprogramme helfen jungen Menschen, praktische Fähigkeiten zu entwickeln (Schindler, 2024; Al-Mahruqi, 2023).
2. Engagement durch Formate und Veranstaltungen:
Workshops, Vorträge und Praxistage eröffnen Räume, in denen Unternehmen Wissen über Branchen und Berufsbilder vermitteln – niederschwellig, praxisnah und motivierend.
3. Finanzielle Unterstützung für Bildungsprojekte:
Beispiele wie KUKAs Sponsoring der Kampagne Cash for Schools zeigen, wie Unternehmen gezielt Bildungseinrichtungen fördern können. Solche Mittel ermöglichen Investitionen in Technik, Bücher oder digitale Infrastruktur – ein direkter Beitrag zur Bildungsqualität (Schoenwetter, 2023).
4. Förderung individueller Bildungschancen:
Über Stipendien wie das Deutschlandstipendium oder eigene Förderprogramme können Unternehmen gezielt Talente ausbilden, die ansonsten möglicherweise nicht studieren könnten (BMBF, 2018).
5. Interne Weiterbildungsprogramme:
Der Blick nach innen ist ebenso entscheidend. Unternehmen, die in ihre Mitarbeitenden investieren, sichern sich langfristig Innovationsfähigkeit und Fachwissen. Gerade in dynamischen Märkten schafft betriebsinterne Qualifizierung entscheidende Wettbewerbsvorteile (Al-Mahruqi, 2023).
Zertifikat
Berufsbegleitend
Angewandte Automatisierungstechnik und Robotik in der Produktion
Fazit: Bildung ist der Schlüssel zur Fachkräftesicherung – Unternehmen müssen handeln
Die Analyse ist eindeutig: Unternehmen müssen Fachkräfte künftig selbst ausbilden – gezielt, strategisch und vorausschauend.
Das ist keine provokante These, sondern eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Notwendigkeit. Hochschulen allein können die bestehenden Qualifikationslücken nicht schließen. Viele bereiten derzeit noch unzureichend auf die realen Anforderungen des Arbeitsmarktes vor – insbesondere, was digitale, interdisziplinäre und anwendungsbezogene Kompetenzen betrifft.
Wer qualifizierte Mitarbeitende sucht, muss selbst Voraussetzungen schaffen. Wer Innovationsfähigkeit erhalten will, muss Bildung als Teil seiner Unternehmens-DNA verstehen. Wer Zukunft gestalten möchte, muss jetzt investieren – nicht morgen.
Prof. Dr. Katrin Winkler
Staatliche Hochschulen allein können diesen Wandel nicht schultern. Der gezielte Ausbau berufsbegleitender und praxisnaher Bildungsangebote – wie er in Bayern im Bereich der Weiterbildungsangebote an Hochschulen bereits anläuft – ist ein erster, wichtiger Schritt. Doch ohne das aktive Engagement der Wirtschaft bleibt er Stückwerk. Bildung darf nicht länger als Aufgabe der öffentlichen Hand allein betrachtet werden. Sie ist ein strategisches Gemeinschaftsprojekt – und Unternehmen stehen dabei in einer Schlüsselrolle.
Literaturverzeichnis
Al-Mahruqi, A. (2023). Warum sollten Unternehmen in Bildung investieren? ProgressSoft.
Belschak, F. D., Den Hartog, D. N., & Caluwe, L. D. (2008). Leading change: The role of leadership style and employee commitment. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17(2), 179–199.
Dämon, K. (2015). Studium bereitet kaum auf den Job vor. WirtschaftsWoche.
Gülbay-Peischard, Z. (2024). Akadämlich: Wie wir unsere Studierenden verlieren. München: Campus Verlag.
Haufe Online Redaktion. (2025). MINT-Fachkräftemangel gefährdet Zukunftsprojekte.
ManpowerGroup. (2025). Global Talent Shortage: Umfrage zum Fachkräftemangel.
Redaktion Personalwirtschaft. (2015). Berufsstart am besten mit Praxiserfahrung.
Rödel, S., & Krach, S. (2023). Professionelles Feedback als entscheidender Erfolgsfaktor in New Work. Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), 54(1), 45–53.
Schindler, H. (21. August 2024). Wie Unternehmen von Schulen profitieren können. Staatsanzeiger.
Schoenwetter, R. (2023). Bildung trifft Business: Gemeinsam junge Talente fördern. KUKA.
Wintergerst, R. (2024). Digitale Hochschulen. bitkom.
Wunderer, R. (2003). Führung und Zusammenarbeit: Eine unternehmerische Führungslehre. Luchterhand.
24.09.2025
Kategorien:
Schlagwörter: